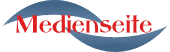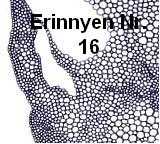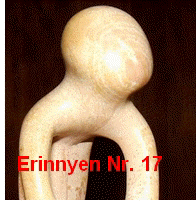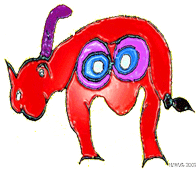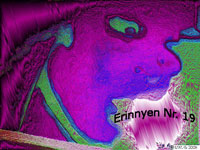|
||
|
|
(B. Gassmann über: In dem Aufsatz „Zur Pathologie des Gehorsams“ (1966) plädiert Brückner für eine rationale und humane Anwendung des Gehorsams. Eine Gesellschaft müsse sich das Ziel setzen, den Prozess der Sozialisation und Enkulturation bewusst zu gestalten und zu beherrschen. Dies gilt auch für die zukünftigen Verhältnisse der „assoziierten Produzenten“ (Marx). Gehorsam, rational verstanden, ist ein notwendiges Moment jeder arbeitsteiligen Gesellschaft. In einer antagonistischen Gesellschaft sind aber alle Beziehungen der Menschen durch die Herrschaft geprägt. Versteinert diese Herrschaft, lässt sie keine Alternative zu, dann wird Ungehorsam zur Menschenpflicht. „Es ließen sich ja Entwicklungen denken, in denen die als ‚pluralistisch’ sich verstehende gegenwärtige Gesellschaft so in blinder Konformität versteinerte, dass Ungehorsam als Verweigerung des Konsensus zur einzigen Tugend würde. Auch die will freilich erlernt sein.“ (66) Ungehorsam muss schon während der Erziehung gelernt werden. Die Frage, „wohin denn eigentlich das gewünschte Verhalten des Zöglings führen soll und welche Ratio das Ziel legitimiert“, muss an jeden gestellt werden, der Gehorsam verlangt. Schon das scheinbar biologische Verhältnis der Mutter zu ihrem Säugling steht „unter einem normativen Zusammenhang“ (69). Die Legitimität dieser Normen des Zusammenhanges sind deshalb zu prüfen. Wie rigide die sein können, macht Brückner an einem Zitat aus dem 15. Jahrhundert deutlich: „Erziehung beugt den Nacken (…)“ (68), eine Methode, die bis ins 20. Jahrhundert weit verbreitet war und heute noch nachwirkt. „Man wird deshalb die Frage zulassen, ob nicht vieles, zu dessen Zügelung es des Gehorsams bedürfte, damit soziales Leben funktioniere, nicht überhaupt erst sozialem Verhalten entspringt.“ (69) Kulturelle Tradition unterscheidet uns vom instinktgeleiteten Tier, diese Tradition muss sich aber an der Vernunft ausweisen, wenn sie Gehorsam verlangen will. Eine repressive Erziehung führt zur Konformität. Ein rationaler Umgang mit dem Gehorsam fängt also bereits mit der Erziehung an. Andererseits ist auch ein Laisser-faire-Stil der Erziehung keine Lösung, da ein gewisser Grad des Versagens notwendig zur Erziehung ist. „Das Toleranzmaß der Eltern und Erzieher ist mit Sicherheit die Funktion ihrer Fähigkeit, inneres Erleben bei sich selbst im Sinne einer gelungenen ‚Bindung der Affekte’ zuzulassen.“ (76) In diesem Zusammenhang kommt Brückner auf die Rolle des Gewissens zu sprechen. Die sozialen Forderungen wandern als regulativer Mechanismus ins Innere, werden zur psychischen Struktur und vertreten die Gesellschaft gegenüber den Triebbedürfnissen. Auch dieser Prozess muss reflektiert werden, im Idealfall ist unser Gewissen die praktische Vernunft des Menschen (Kant). Meist geschieht die Verinnerlichung der Normen der Gesellschaft aber unbewusst, sodass wir später kaum kritischen Abstand zum Gewissen, dem Über-Ich, gewinnen können. Die Imperative versteinern, das Gewissen indoktriniert das Ich, also das Realitätsbewusstsein, es wird starr wie die Vorurteile, die als eigene Urteile erscheinen. „Über den Gang des Denkens entscheiden dann nicht die Sachzusammenhänge, denen der Gedanke sich widmet, sondern vorgeschaltete Normensysteme, die dem, was rational wäre, seinen Weg vorzuschreiben trachten.“ (78) Brückner fordert deshalb: „wer nachdenkt, sollte gewissenlos werden“. Erziehung zur politischen Reife setzt voraus, dass Denken von Tabus befreit wird. „Dies kann keiner kommandieren“, sondern es verlangt die Selbsttätigkeit des Individuums. Im Gegensatz zu den in autoritären Erziehungsstilen kollektiv verhängtem Verbot, außerhalb der zugelassenen Probleme „zu suchen, zu zweifeln, zu fragen“ usw., das bis in die 60er Jahre noch weit verbreitet war, gilt heute eher das Gegenteil: Man hinterfragt alles, um in der Buntheit von Thesen, Hypothesen, Reflexionen und kritischen Fragen, jeden konkreten Gedanken zu ertränken, zu relativieren, um dadurch das kritische Potenzial der Gedanken zu neutralisieren und sich zu entledigen. Peter Brückner fordert eine „Reife des Ungehorsams“. Schon die Erziehung soll nicht nur in die Gesellschaft einüben, sondern „gleichzeitig gegen sie immunisieren“. Statt eines Gehorsams gegenüber seinen teils unbewussten und unreflektierten Gewissen fordert er einen „Ich-Gehorsam“ (82). Dazu, so fügt der Rezensent an, gehört heute auch, dass man seinem Denkvermögen traut und sich nicht durch Relativierung aller Gedanken und durch Zumutungen von anderen dumm machen lässt. Brückner fordert eine „zweite Aufklärung“, „die das Vernünftige mit dem Antreffbaren dadurch zur Deckung bringen will, dass sie das Antreffbare korrigiert und nicht Einsicht zur Dublette dessen macht, was gerade so ist, wie es ist“. (85) Diese Art der Aufklärung „würde sich freilich niemals in der Reflexion allein bewegen können“, sie müsste auch als „demokratische Politik“ auftreten, sie zwingt zu der Frage, welche gesellschaftlichen Bedingungen zu schaffen sind, die der Befreiung jedes einzelnen Individuums günstig sind. Deshalb gehört zum Ich-Gehorsam und zum gesellschaftlichen Ungehorsam politische Aktivität. In seinem „Nachruf auf die Kommunebewegung“ (1972) beschäftigt sich Brückner mit der Sozialpsyche derjenigen, deren primäres Ziel die Bewusstseinsveränderung war, was auch eine qualitative Veränderung ihrer sozialen und sexuellen Beziehungen einschloss. Der „Nachruf“ soll kein Abgesang sein, sondern das vorläufige Scheitern der „hedonistischen Linken“ analysieren. Die jungen Leute in diesen Kommunen (21 oder 23 Jahre alt) kommen aus einem bürgerlichen Elternhaus, dessen Autoritätsstrukturen sich verändert haben. Sie sind gekennzeichnet durch „Idiosynkrasie gegen körperliche Gewalt“ (93), zugleich wird die Strenge an andere Institutionen wie Schule und Polizei abgewälzt. Durch diese widersprüchliche Erziehung sind die jungen Menschen sensibilisiert gegenüber verschleierten Formen unreflektierter Autorität. Sie streben andere Formen des Zusammenlebens an. So kritisieren sie die Eigentumsverhältnisse: die Ordnung des familiären Lebensraum in Reviere, „Herr ist, wer Dinge besitzt“ (95), leiden aber andererseits unter der Unmöglichkeit, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das hat zur Kommunebewegung geführt, alternative Lebensformen in einem feindlichen Umfeld zu antizipieren. „Das Denken an Lust und die Lust am Denken sollen sich hinfort nicht mehr ausschließen“ (101). Doch auch ihre Charakterstruktur ist von den „Verkehrsformen spätkapitalistischer Tausch- und Leistungsgesellschaft unbewusst“ geprägt (96). Sie haben unbewusst „bestimmte bourgeoise Verhaltensweisen reproduziert“ (102). Aus der Kritik an dualen Liebesbeziehungen wurde z. B. die „Flüchtigkeit fast aller Objekt- und Liebesbeziehungen“ oder es kam zu einem „schwer zu ertragenden Schwund an Zärtlichkeit“ (102). Es ist ihnen kaum gelungen „ihre Emanzipationsbestrebungen dauerhaft zu organisieren“. Dafür sind nicht nur sie selbst verantwortlich, sondern auch die sich wieder versteinernde Gesellschaft. „Denn jedes Mehr an Lust, jedes Mehr an individueller Produktivität, jedes Mehr an Selbstfreigabe auf der Seite des Bewusstseins, das sich gegen die eben geschilderten Verhältnisse auflehnt, muss das Produkt eines Mehr an objektivierbaren Veränderungen der sozialen und politischen Verhältnisse der Gesellschaft überhaupt sein. Das hat nicht stattgefunden.“ (101) Aus der Erfahrung der Linken in ihrer Geschichte kann man lernen, dass „inselartig, autark gegen die sie umgebende Gesellschaft ein eigenes Feld sozialer Realität zu schaffen“ eine „Regression ins Getto der Gegengesellschaft“ ist. (105) Die Warentauschgesellschaft erlaubt keine anderen Verkehrsformen neben sich, es sei denn als „autarkes Elend“ (106). Dennoch war die Intention der Kommunebewegung legitim: Die Intention, Bewusstsein umzuwerfen, die Struktur zwischenmenschlicher Beziehung zu verändern, brüderliche Solidarität zu üben, Ansätze zu einer neuen Moral zu entwickeln, die subjektiven Emanzipationsbedürfnisse in gemeinsamer Arbeit für die Emanzipation aller Menschen einzubringen. Das Scheitern der Kommunebewegung war auch durch Denunzierung und Kriminalisierung des antiautoritären Protestes „durch den Justizapparat und seine Handlanger“ (108) bedingt. Viele haben sich auf alte Lebensformen wie die Familie zurückgezogen oder es entstanden „Gruppen und Grüppchen, die sozialistische Politik unter dogmatischen Rückgriff auf sehr traditionelle Formen von Organisation“ (108) betrieben, d.h. die emanzipatorische Seite sozialer Veränderung verleugneten. Für Brückner ergibt sich aus den Erfahrungen der Kommunebewegung ein Widerspruch: Einerseits kann sozialistische Politik nicht auskommen ohne „sinnliche Fülle, ein Mehr an Lust, einzig durch Solidaritätsbeziehungen gebunden“ (110), will sie nicht ihren Emanzipationsanspruch aufgeben, andererseits sind dazu „umfangreiche politische und ökonomische Veränderungen“ notwendig, die einen „disziplinierten Revolutionär“ erfordern, der sich gerade dieses Mehr an Lust versagen muss. Brückners Fazit 1972: „Leider kann man feststellen, dass heute das Aushalten und Bewältigen dieses Widerspruchs nicht mehr auf der Tagesordnung der Linken steht. Diese Tatsache kann dazu beitragen, dass das Bewusstsein eines antiautoritären Sozialisten von Trauer überschattet wird.“ (110) In seinem Aufsatz über „Zivilcourage am unsicheren Ort“ (1979) geht Brückner auf die Geschichte der Zivilcourage in der bürgerlichen Emanzipationsbewegung ein. Er zeigt auf, dass Zivilcourage auch immer mit Klugheit gepaart war. 1979 ist sie für ihn, ein alternatives Bewusstsein überhaupt noch zu haben. „Die Realität könnte anders sein: Dies noch zu sehen ist – schon - Zivilcourage.“ (117) Die eindimensionale Realität aufbrechen, auf dem Besonderen zu bestehen (gegen dessen Verunglimpfung als „Sicherheitsrisiko“), den Funktionieren, dem Machbaren und dem Sachzwang zu widerstehen ist für ihn Zivilcourage. Doch auch in der Tugend der Zivilcourage muss unterschieden werden: „Zwar stabilisiert Moral – als ‚Kampfmoral’, Mut, ‚Bekenntnis’ – den Schein, als ginge es noch moralisch, also geschichtlich zu. Insofern wäre Zivilcourage Theaterdonner, der dem Spektakel der dominierenden Struktur zu Buch schlägt. Doch nur eine solche Moral des Mutigen, des ‚Bekennenden’ kann in der Realität des posthistoire noch das Besondere, die Qualität, verteidigen und damit den einzigen Haltegriff in der bröckligen Glätte der Normalität.“ (119) Den Text über „Anarchismus – oder: Caliban und sein Spiegel“ (1972) übergeht der Rezensent aus Platzgründen. Nur soviel: Die Mitglieder der „Roten Armee Fraktion“ wurden als Anarchisten bezeichnet, das ist jedoch falsch, denn sie waren zu weit weg von der emanzipatorischen Seite des Anarchismus. Der letzte Aufsatz ist betitelt: „Über linke Moral“ (1980/81). Eine linke Moral muss an den progressiven Epochen der bürgerlichen Emanzipation anknüpfen. Zur bürgerlichen Kultur gehörte: „die aufmerksame Rücksichtnahme auf die Gefühle anderer“, „ein Gespür für die Besonderheit des Gegenübers“, „Einfühlung in andere(s)“, dazu gehört „Parteilichkeit (…) für die je Leidenden und gegen die Gewalt, die ihnen rücksichtslos angetan wird“ (S. 127). Doch wer diese Moral praktiziert, vielleicht sogar verinnerlicht hat, gerät bald in Konflikt mit der Klassengesellschaft, er wird plötzlich vereinzelt, ausgenutzt, er lernt Infamie kennen. Das gilt schon für Kinder, wenn sie die behütete Umgebung des Elternhauses verlassen, in den Kindergarten oder die Schule kommen. Sie lernen den Widerspruch kennen, dass Täter und Opfer manchmal eine Person sind. In diesem Zusammenhang kommt Brückner auf die Gewissensbildung zu sprechen; die war in den früheren Aufsätzen vorwiegend negativ gekennzeichnet, nun erscheint auch ihre positive Seite: „Denn Gewissen bildet sich im Mitgefühl mit den Opfern.“ (129) Doch auch im erwachsenen Alter tritt die Infamie auf. Der sensible Mensch muss sein Gewissen belehren. Er muss den Widerspruch bewältigen, der in einer Praxis liegt, die antagonistisch geprägt ist. In der Sphäre der Praxis „entsteht fortwährend die Gefahr, dass die dialektische Spannung von Friede und Militanz zusammenbricht, beide Momente sich voneinander lösen und sich verabsolutieren – etwa in Legalismus hier und Terror dort, in ‚Innerlichkeit’ und Verbrechen. Oder: Die ‚Liebe’ wird hier, der ‚Hass’ wird dort zum Fetisch.“ (129) Hält man diesen Widerspruch nicht aus, verabsolutiert man eine Seite, meist die der Gewalt, dann entspringt daraus eine neue antagonistische Herrschaftsordnung, die noch nicht einmal die „halb-humane Konvention der alten Herrschaftsform“ (129) beinhaltet. Diese Kritik an den dogmatischen Sekten und den bürokratischen Kollektivismus des ehemaligen Ostblocks verlangt nach einem moralisch bestimmten Kriterium, wann ein Sozialist eine solche Bewegung verlassen muss. Brückner formuliert dieses Kriterium so: „Die Moral, die verändern will, macht den Einzelnen organisierbar, zumindest kooperationsbereit, eine Konsequenz schon des sozialen Charakters von Mitgefühl, Einfühlung und Rücksicht. Und doch: Wenn seine ‚Partei’ einem der skizzierten Widersprüche erliegt – nur noch Friede oder nur noch Gewalt ist, nur noch Theorie oder nur noch Parteilichkeit (die dann historische, menschliche Details abschaffen wird wie Agenten der Konterrevolution, so Jean-Paul Sartre), wenn die eigene Gruppierung das Problem des ‚Infamen’ wegrationalisiert, verharmlost oder selbst infam wird – dann muss der Einzelne seiner ‚Partei’ gegenüber jene Leistung erbringen, die er, störrisch gegenüber dem Ganzen, dem Herrschaftszusammenhang, längst erbracht hat: die, nicht mitzumachen. Die Tugend, gegebenenfalls nicht mitzumachen, in der Kindheit eingeübt – das erst wäre, individuell und ‚links’, Autonomie.“ (130) Es bleibt hinzuzufügen, dass diese rationale Argumentation auch zur Rationalisierung mangelnden Engagements missbraucht werden kann, sich ins Privatleben zurückzuziehen, das Abseits zu vergöttern oder gar zum Gegner überzulaufen. Kritik Am Ende dieser Rezension sollte eine Kritik stehen. Doch inhaltlich habe ich wenig zu kritisieren. Gewiss sind einige psychische Mechanismen, die Brückner analysiert, historisch vergangen oder nur noch als Ungleichzeitigkeit vorhanden. Das Wissen darum gehört aber zur Menschenbildung, schon damit verknöcherte Autoritätsstrukturen, die Mitläufer produzieren, nicht mehr wiederkehren. Das soll aber nicht heißen, dass die vorherrschende soziale Psyche heute als Ganze viel besser wäre. Noch immer ist der Mitläufer der dominierende Typ, wenn auch aus anderen psychischen Dispositionen heraus, weil Herrschaft fortbesteht und auf ihre massenhafte psychische Verankerung nicht verzichten kann. Was man an dem kleinen Werk kritisieren kann, sind einige problematische Begriffe, die aus Theorien stammen, die mehr bürgerliche Ideologie sind als wissenschaftliches Denken. Heute wird von jedem Ideologen das Gesamtwerk publiziert, das dann in den Bibliotheken verstaubt. Die kritische Wissenschaft von Brückner, die eine heute wieder erstarkende linke Bewegung dingend bedürfte, ist in form von Gesammelten Werken noch nicht einmal geplant. Je mehr Leser Brückners kleines Buch bekommt, umso eher wird sich ein Verlag finden, der diese Gesamtausgabe in Angriff nimmt. Diese Rezension soll dazu beitragen. Es bleibt das Verdienst des Wagenbach-Verlages mit diesen lesenswerten Büchlein ein Gegengewicht gegen die Abwickler der „68er“ herausgegeben zu haben. Brückners Aufsätze sind die Originaldokumente eines versuchten Aufbruchs der Linken, sie analysieren aber auch die Gründe für sein Scheitern, nicht im Gestus der Häme, welcher die Schreiberlinge der Klassengesellschaft auszeichnet, sondern Brückner ist teilnemender Begleiter, ein solidarischer Psychologe und Sozialist. Zurück zum AnfangZurück zur Inhaltsübersicht Rezensionen
Hier können Sie Ihre Meinung äußern,
|
Unser Internetbuchladen:
|
|
© Copyright: Alle Rechte liegen bei den Erinnyen. Genaueres siehe Impressum. Letzte Aktualisierung: 08.09.2008 |
||